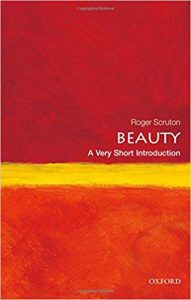Des Menschen Element. Ein Stück Fundamentalpoesie.
Für die heutigen Lyriker und Lyrikerinnen ist Adornos Dictum „Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch[1], barbarisch. Daher hielt und hält sich keiner von ihnen daran, denn:
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.[2]
Lyrik ist wie jede gute Literatur kein Luxus, sondern zusammen mit Essen, Trinken und Sex ein fundamentales Grundbedürfnis des Menschen, ja Lyrik schreiben und verstehen zeichnet ihn geradezu als Kulturwesen aus. So gesehen wird es, wie schon Shakespeare es in seinem berühmten Sonett ausgedrückt hat, Lyrik geben, solange es Menschen gibt.
Lyrik als hochreflektierende literarische Kunst, die mit ihren Methoden Unsagbares zum Vorscheinbringen und zähmen kann, nahm seit je an der literarischen Verarbeitung von großen Menschheitstraumata und -katastrophen teil. So finden sich in allen Kulturen aus allen Jahrhunderten seit der Verschriftlichung von Kultur lyrische Zeugnisse über Gräueltaten und Genozide. Die bekanntesten poetischen Schilderungen finden sich im Tannach bzw. dem Alten Testament[3].
Als Adornos seine apodiktische Aussage formulierte, war sie durch die lyrische Praxis schon längst widerlegt. So hatte der spätere Nobelpreisträger Czesław Miłosz bereits 1945 das Gedicht Armer Christ sieht das Ghetto geschrieben, und viele weltbekannte Dichter auch aus dem deutschen Sprachraum sollten ihm folgen, wie etwa Paul Celan, der zwischen seine Todesfuge[4] zwischen 1944 und 1945 geschrieben und 1947 erstmals veröffentlicht hatte oder Nelly Sachs, deren Zyklus In den Wohnungen des Todes 1949 erschien.
Adorno hat seine Aussage noch einmal bekräftigt und erst später versucht, sie abzuschwächen: „Das perennierende Leiden hat so viel Recht auf Ausdruck wie der Gemarterte zu brüllen; darum mag falsch gewesen sein, nach Auschwitz ließe sich kein Gedicht mehr schreiben. Nicht falsch aber ist die minder kulturelle Frage, ob nach Auschwitz noch sich leben lasse, ob vollends es dürfe, wer zufällig entrann und rechtens hätte umgebracht werden müssen“ [sic].[5] Möglicherweise sah Adorno, wie auch andere, in der lyrischen und überhaupt künstlerischen Bearbeitung von menschlichem Leid die Gefahr einer ästhetischen Stilisierung: „damit allein schon widerfährt den Opfern Unrecht, während doch vor der Gerechtigkeit keine Kunst standhielte.“ Andere sehen bezüglich der Post-Auschwitz-Kunst für die Generationen von Nachgeborenen das Problem, dass Kunst, mithin auch Lyrik, eine potentiell versöhnliche Wirkung habe : „Von allen Problemen, mit denen sich Schriftsteller und Künstler nach dem Holocaust konfrontiert sehen, scheint in der Tat keines gravierender und lähmender zu sein, als das Dilemma, dass jede Darstellung des Holocaust von potentiell versöhnlicher Wirkung ist.[6]“
Aber, so fragen wir heute, die wir inzwischen von vielen anderen Genoziden wissen und geprägt sind, ist es nicht gerade die Literatur und die Kunst, die den Opfern von Genozid, Krieg und Vertreibung ihre Würde gerade auch durch eine empathische, das Individuum betreffende, Ästhetisierung zurückgibt, ganz gleich ob es sich dabei um Armenier, Juden, Sinti, Roma, Palästinenser, Tutsi oder Kosovaren handelt?
Und ist es nicht so, dass die Literatur, eben auch die Lyrik, auf die Opfern und Täter und ihre Nachfahren eben auch eine versöhnende Wirkung haben kann?
Allerdings, muss man, um mit Konfuzius[7] zu sprechen, als Dichter stets im Auge behalten, dass, „wenn die Begriffe nicht richtig sind, die Worte nicht richtig sind, und wenn die Worte nicht richtig sind, die Werke nicht entstehen, Moral und Kunst nicht gedeihen“. Genau deshalb muss der Lyriker darauf achten, dass er die richtigen Begriffe verwendet, damit das Leiden mit Worten beschrieben wird, die den Opfern ihre Würde zurückgeben und den Überlebenden eine einfühlsame Erinnerung ermöglichen.
Dies ist Ellen Hinsey in eindrucksvoller Weise mit dem Langgedicht Des Menschen Element / The Human Element gelungen, das kürzlich in einer deutsch-englischen Ausgabe bei Matthes & Seitz erschien.
Das Werk beginnt mit lapidaren Aussagen, die jeweils in kurzen strophischen Blöcken daherkommen, die aus zwei bis drei Zeilen bestehen, elegische Distichen imitieren und an archaische Inschriften erinnern:
In jener ersten Stunde, die schwebt am Rande der Dunkelheit,
wenn das Jetzt sein Licht unvermittelt entfaltet –
In jenem allerersten Augenblick – Horizont aus unerzeugtem Honig,
Orakel, ungeformtes Sein – an jenem einmaligen Saum
[…]
In jenem Moment, da sich an jenem Rand, aus jenem Reich, das
Mögliche ins Sein erhebt – sodass das Wirkliche
Herankommt, sich der Verkörperung nähert; sodass mit ebenjenem
Anbruch des Lichts alles erglüht…
Und so schreibt die Autorin Seite für Seite ihre freien Versen fort, bis schließlich das Hauptaugenmerk klar wird:
1.
Gegebenheit
Bei der Hand hat sich nichts geändert, schlägt ihre Stunde,
ist sie folgsam und gefällig
2.
Naturell
Trotz ihres Unverstands ist sie immer von ihrer rechtmäßi-
gen Befugnis überzeugt
3.
Genese
Mal um Mal erhebt sie sich aus den Wäldern der Vorzeit –
Gehüllt in den Duft barbarischer Notwendigkeit
4.
Übereinkunft+
Ihre Schuld ist schnell gemildert. Die erhobene Hand ist
Eine Litanei von Rechtfertigungen
Wären Hinseys Verse nicht von solch elementarer poetischer Kraft, würde man von den Aussagen, die sie anbietet, überwältigt werden. Sie bemüht sich sehr, diese Aussagen, die sehr intensiv sind und die völkermörderischen Schrecken widerspiegeln, wie das objektive Ergebnis einer gründlichen Untersuchung der Realität erscheinen zu lassen.
Hinsey, die an mehreren Anhörungen für Verhandlungen von Völkermord am Internationalen Gerichtshofs in Den Haag teilgenommen hat, versucht, an den Tatsachen, die sie sich notiert hat, festzuhalten und sie dennoch poetisch zu machen. Das erscheint durchaus in Ordnung, solange sie damit die Würde des Opfers wiederherstellt. Und das tut sie. Insgesamt hat sie die beeindruckende Fähigkeit, die schrecklichsten Aspekte des menschlichen Lebens zu einer gnädigen Erzählung zu machen und so dem Leser die Erkenntnis zu vermitteln, dass nicht nur der andere zu grausamen Taten fähig ist, sondern dass einfach jeder Mensch, prinzipiell auch der Leser, fähig ist, die schrecklichsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen.
Nach der Lektüre des Buches wird man sehr nachdenklich zurückgelassen. Und doch hat das Nachdenken etwas Produktives, denn man merkt schließlich, dass Hinsey bei aller Ästhetik eine realistische Welt zeichnet.
Der einzige kleinere Fehler, den man zu beklagen geneigt ist, ist, dass die Autorin ihr beeindruckendes Werk erheblich hätte verbessern können, wenn sie nicht, wie sie es manchmal tat, allzu vereinfachende Erklärungen zu den Ursachen des (völker)mörderischen menschlichen Verhaltens gegeben hätte. Insbesondere die (hyper)ethische Haltung, die sie manchmal annimmt, war keineswegs notwendig. Als Dichterin hätte sie wissen müssen, dass Poesie letztlich nur existieren kann, selbst wenn sie sich mit den grausamsten Aspekten des Lebens auseinandersetzt, wenn sie nicht von der Ethik gefesselt ist, sondern frei im Reich der Ambiguität schweben darf. Denn die wahre Grammatik des Lebens ist die Wahrheit mit all ihren Aspekten, von denen einige eben nur in der Zweideutigkeit zu finden sind.
Hinseys wirklich einzigartiges Buch verdient unbedingt so viele Leser wie möglich, zumal es mit Uta Gosmann eine kongeniale Übersetzerin gefunden hat, die den Duktus und Tonfall des englischen Originals auch im Deutschen nachempfinden lässt.
[1] Kiedaisch P. (Hrsg.) Lyrik nach Auschwitz. Adorno und die Dichter. Reclam, Philipp, jun. GmbH, Verlag, Stuttgart 1995
[2] Die beiden Zeilen repräsentieren das finale heroische Couplet des 18. Sonetts von W. Shakespeare
[3] Naimark N.M. Genocide- A world history, Oxford University Press, New York, NY, 2018, 8-10
[4] Celan P. Mohn und Gedächtnis, DVA, München 1952
[5] Adorno TW, Negative Dialektik. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1966 (Erstausgabe)
[6] Ebd.
[7] Zitiert nach Hinderer W. Politische Lyrik Eine heikle Angelegenheit. Literaturkritik, 5, 2012