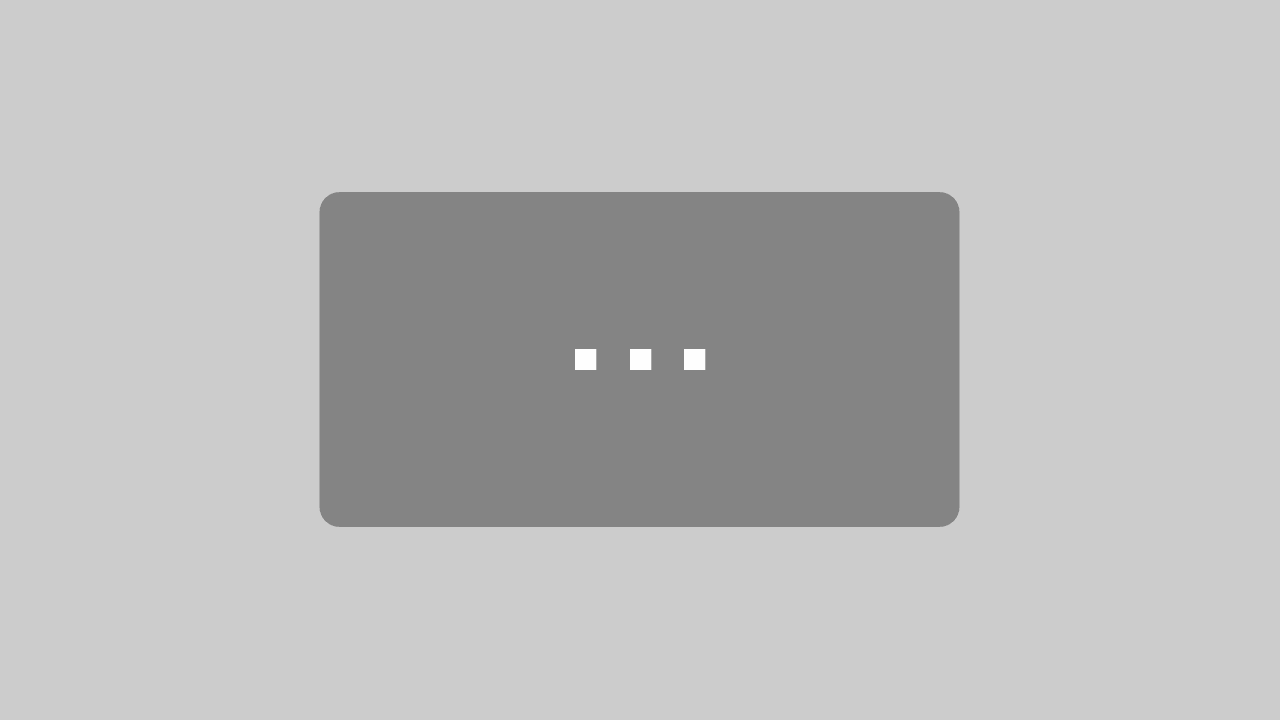Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich begrüße Sie ganz herzlich zur diesjährigen Würzburger Amichai-Lesung. Es ist bereits die dritte Lesung, die wir zu Ehren von Jehuda Amichai durchführen, der 1924 in Würzburg als Ludwig Jehuda Pfeuffer geboren wurde und die hebräische Lyrik revolutionieren und zu dem international erfolgreichsten Lyriker Israels werden sollte.
Wegen der Corona-Pandemie bieten wir Ihnen dieses Jahr die Möglichkeit, der Lesung sicher von zu Hause aus beizuwohnen.
Das Besondere an der diesjährigen Lesung ist, dass sie genau zwanzig Jahre nach dem Tod des großen Dichters, der im September 2000 in Jerusalem gestorben ist, stattfindet.
Es schien mir daher angemessen, dieses Jahr besondere Gedichte für diese Lesung auszuwählen, die ein bisschen persönlicher auf Jehuda Amichai eingehen und eine besondere Vorliebe von Amichai reflektieren.
Jehuda Amichai liebte es nämlich, sich in Cafés aufzuhalten. Diese Vorliebe, die er mit vielen anderen Dichtern teilt, war bei ihm offenbar sehr stark ausgeprägt. Denn in nicht wenigen seiner Gedichte ist von Kaffeehäusern die Rede. Lyriker sind ja von Haus aus genaue Beobachter. Und wo könnte man Menschen besser beobachten, wo könnte man besser ihren Gesprächen zuhören als in einem Café. Zumal sich hier das lyrische Geschäft des Beobachtens, des Zuhörens, des Ins-Gespräch-Kommens mit dem Vergnügen des Kaffeetrinkens verbinden lässt.
Amichai war ja beides: Ein sehr guter Menschenbeobachter & ein Genießer.
Die Altstadt-Cafés in Jerusalem scheinen es ihm dabei besonders angetan zu haben. Vor allem das Café Ataráh und das Café Tmol Schilschom.
Das Café Ataráh, auf Deutsch Café Krone, war von deutsch-jüdischen Auswanderern gegründet worden und ein Treffunkt der Jeckes.
Hier saß Amichai oft, weil es ihn an Deutschland und die schmerzlich vermisste Würzburger Heimat erinnerte.
Er hat dem Ataráh in zwei seiner Gedichte ein literarisches Denkmal gesetzt, wobei sich das eine auf das Atarah in Haifa bezieht, das andere auf das Jerusalemer Atarah bezieht.
Auch das Café Tmol Schilschom, auf Deutsch „Erst Gestern“ mochte Amichai sehr gerne. Es ist ein Lese-Café, in dem man, wie in den USA üblich, Bücher kaufen und gleichzeitig Kaffeetrinken kann.
David Ehrlich einer der Besitzer des Cafés war Literaturbegeistert, schrieb auch selbst und war mit Jehuda Amichai befreundet, der für ihn zur Café-Eröffnung 1994 eine Autorenlesung veranstaltete.
Daraus wurde eine Art Tradition. Nach Amichai haben im Tmol Schilschom viele andere berühmte Autoren gelesen: Etwa Amoz Oz, David Groszmann, oder Nadine Gordimer.
Begleiten Sie mich nun auf eine lyrische Reise durch Jehuda Amichais Café-Gedichte.
Erlauben Sie mir vorher noch ein Wort zu meiner Gedichtauswahl:
Warum habe ich Café-Gedichte für die diesjährige Amichai-Lesung ausgewählt?
Nun Amichai hat über ein Dutzend Café-Gedichte geschrieben und mir scheinen diese Gedichte deshalb besonders wichtig, weil sie uns einen Einblick in die Arbeitsweise von Amichai geben.
Im meine damit weniger die Tatsache, dass Amichai gerne Cafés besuchte, um dort mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt zu kommen. Das natürlich auch.
Ich meine vor allem Amichais Schreib-Stil. Mit dem Auftreten der Café-Gedichte ab 1974 lassen sich nämlich viele Besonderheiten im lyrischen Stil und Gestus der Gedichte ausmachen, die sich vorher nicht bei Amichai finden.
Während in den Gedichten vor 1974 nur ganz selten ein „lyrisches Ich“ als Sprecherinstanz auftritt, sondern das „kollektives Wir“ dominiert, ändert sich nun die Lage mit Auftreten der ersten Café-Gedichte schlagartig:
Nun beherrscht „ein lyrisches Ich“ als Sprecherinstanz die Gedichte.
Gleichzeitig führt Amichai ab 1974 unter dem Einfluss der angelsächsischen Modernisten, wie etwa T.S. Eliot, die Technik des inneren Monologs ein.
Bezogen auf unsere Café-Gedichte heißt das, dass ein lyrisches Ich in einem Café-Haus sitzt und dort in einer Art Stream of Consciousness, einer Art Bewusstseinsstrom sich ganz unterschiedliche Dinge durch den Kopf gehen lässt.
Da das Auftreten der Café-Gedichte mit dieser stilistischen Wende einhergeht, können die Café-Gedichte quasi als Marker für den neuen Stil Amichais dienen.
Nun aber genug Theorien!
Lassen Sie mich Ihnen nun einige ausgewählte Café-Gedichte vorstellen, die einen gewissen Bezug zu Amichais eigener Biografie haben.
Unser erster Besuch führt uns in ein amerikanisches Café.
Amichai war ja des Öfteren in den USA, hat an Lesungen teilgenommen und Sommerkurse für Lyrik abgehalten.
So kam er auch nach Kalifornien, wo er das folgende Gedicht in einem Café in San Franzisco situiert.
Es hat den Titel: Der Name des Lokals war „Trieste“.
In der kurzen ersten Strophe wird ein Mann vorgestellt, der vom amerikanischen Gangster-Mythos inspiriert scheint.
In der zweiten Srophe, die den Hauptteil des Gedichts ausmacht kommt Amichai auf das biographische Erlebnis seiner Emigration 1936 aus Deutschland zu sprechen.
Im Sommer 1936 fuhr die Familie Pfeuffer von Würzburg mit dem Zug bis ins italienische Triest, um von dort aus mit dem Schiff „Gerusalemme“ nach Haifa überzusetzen.
Die Emigranten wurden seinerzeit schon unterwegs auf ihre neue Heimat in Palästina und die Ideologie des Zionismus quasi in Intensivkursen vorbereitet.
Diese Vorbereitung hat sich dem damals Zwölfjährigen so stark eingeprägt, dass er es im Gedicht als „Einhämmern“ beschreibt.
Die letzte Strophe zeigt, dass dieses Einhämmern vom jungen Dichter nicht gerade als angenehm empfunden worden sein muss:
Hier also das Gedicht:
Der Name des Lokals war Trieste
Ich saß in einem Café in San Franzisko.
Der Mann in der Mördermaske war innen
weich wie der Bauch des Ermordeten.
Der Name des Lokals war „Trieste“
wie der Name der Hafenstadt, von der aus
unser Schiff nach Israel auslief.
Dort war ich wie ein nagelneuer Nagel,
den man wie mit einem Hammer einschlug,
durchs ganze Mittelmeer
bis nach Eretz Israel.
Nichts verschwindet aus der Welt:
Was auf dem Schiff die drei Masten waren,
das sind jetzt drei Seufzer in mir, in mich hinein
Wir machen nun einen größeren zeitlichen Sprung in der Biographie von Amichai und kommen nach Haifa, als er sein erstes Studium abgeschlossen hatte und in der Hafenstadt als Lehrer unterrichtete.
Das Gedicht ist im Café Atarah in Hadar Ha-Karmél situiert, in dem Stadtteil Haifas, der sich an den Nordhang des Karmel anschmiegt.
Der Vater, ein sehr frommer orthodoxer Jude, besucht den Sohn zur Zeit des Mittagsgebets, weiß aber, dass sein Sohn inzwischen nicht mehr betet.
Er spielt mit ihm Schach, statt ihn, wie früher in Würzburg, mit in die Synagoge zu nehmen.
Durch die Metapher des Schachspielens wird nicht nur der Glaubenskonflikt zwischen Vater und Sohn beschrieben, sondern, weil das Spiel mit einem Matt endet auch die verfahrene politische Situation zwischen 1947 und 1948, die damals zwischen Juden und Arabern in Mandatspalästina herrschte.
Die britische Schutzmacht Palästinas hatte im November 1947 ihr Mandat an die UNO abgegeben und sich am 14. Mai 1948 endgültig aus Palästina zurückgezogen. An diesem Tag wurde der Staat Israel ausgerufen.
Vorher war es nach Verkünden des UNO-Teilungsplans für Palästina im November 1947 zwischen Juden und Arabern zu Unruhen und Schießereien gekommen, die rasch in den Krieg mündeten, der später in den jüdischen Geschichtsbüchern als Israelischer Unabhängigkeitskrieg, in den palästinensischen als Nakbah, als Katastrophe, bezeichnet werden sollte.
Die Soldaten, die von 1947 bis 1949 für Israels Unabhängigkeit gekämpft hatten, und Amichai gehörte auch dazu, wurden später als die 48er-Generation bezeichnet. Darauf nimmt das vielschichtige Gedicht in der Schlusszeile Bezug.
Begegnung mit dem Vater
Mein Vater kam zu mir in einer Pause
zwischen zwei Kriegen oder zwischen zwei Liebesaffären
wie zu einem Schauspieler, der sich hinter der Bühne im
Halbdunkel ausruht,
so kam er zu mir: Wir saßen im Café „Atarah“
in Hadar ha Karmel. Er fragte nach meinem kleinen Zimmer
und ob ich mit dem schmalen Lehrergehalt auskäme.
Papa, Papa, bestimmt hast du vor mir Kirschen gemacht,
die du liebtest, schwarze Kirschen, mit viel Rot darin!
Meine Brüder, meine Brüder, süße Kirschen aus dieser Welt.
Es war zur Zeit des Abendgebetes,
mein Vater wusste, dass ich nicht mehr betete
und sagte, komm lass uns Schach spielen,
so wie ich es dir als Kind beibrachte.
Es war im Oktober 1947,
vor den Schicksalstagen und den ersten Schüssen.
Damals wussten wir noch nicht, dass ich mal zur »Generation 48«
gehören würde,
damals, als ich Schachmatt mit meinem Vater spielte, 1948-Matt.
Das nächste Gedicht spielt zu einem viel späteren Zeitpunkt in der Biographie Amichais; diesmal im Café Ataráh in Jerusalem.
Ausgehend von der biographischen Situation, dass nun der Vater gestorben ist, erinnert sich der Sprecher an früher, schlägt einen Bogen zum Krieg und kehrt wieder zurück zu dem Sohn, der sich nun in der Vaterlosigkeit eingerichtet hat:
Zweite Begegnung mit meinem Vater
Wieder traf ich meinen Vater im Café Atarah
Dieses Mal war er schon tot. Draußen mischte der Abend
Vergessen mit Erinnern, so wie meine Mutter
immer Kalt mit Warm in der Badewanne mischte.
Mein Vater hatte sich nicht verändert, aber das Café Atarah
war frisch renoviert. Ich sagte: Glücklich, die
eine Bäckerei direkt im Café haben,
sie können hineinrufen: „Noch mehr Kuchen,
mehr Süßes, bringt mehr, bringt mehr!“
Glücklich die, die ihren toten Vater in der Nähe haben,
sie können ihn jederzeit rufen.
O, dieses ewige Kindergeschrei:
„Ich will, ich will!“
Bis es zum Schrei von Verwundeten wird.
O mein Vater, Fahrzeug meines Lebens, ich will
mit dir fahren, nimm mich ein bisschen mit,
setz mich dann neben meinem Haus ab
und fahre alleine weiter.
Wir gingen. Ein Mann blieb in der Ecke sitzen,
eine Hand war ihm amputiert.
(Beim letzten Treffen hatte er noch zwei Hände.)
Er trank Kaffee, stellte die Tasse hin,
aß Kuchen, legte die Gabel weg
und blätterte in einer Illustrierten,
legte sie weg
und die Hand auf die Zeitung,
ließ sie liegen und entspannte sich.
Wer Amichais Werk kennt der weiß, dass die Vater-Figur in diesem Gedicht allegorisch für den orthodoxen Glauben und letztlich für Gott steht.
So heißt es etwa in dem Gedicht Meiner Eltern Bleibe:
Mein Vater war Gott und wusste es nicht.
Damit bietet sich für „Zweite Begegnung mit dem Vater“ nicht nur eine zwischenmenschliche, sondern auch eine religiös-moralische Lesart an,
nämlich die, dass der lyrische Sprecher nun gelernt hat, ohne Vater, ohne dessen Glauben und ohne dessen Gott zu leben.
Der Sohn scheint zwar irgendwie amputiert, aber doch zurecht zu kommen.
Das nächste Gedicht „Der wunderbare Bäcker“ ist nicht weniger philosophisch als das vorangegangene, es kreist um die Themen Erinnern, Beständigkeit, Seele und Tod.
Das Gedicht ist in Ramathaijm im Ephraim-Gebirge situert und hat damit einen deutlichen biblischen Bezug, stammt doch der Überlieferung nach der Prophet Shmuel von dort.
Der Name Wilheim lässt vermuten, dass das Café von einem deutschen Einwanderer gegründet wurde.
Der wunderbare Bäcker
Ich saß in den Morgenstunden im Außenbereich des Café Willheim
in Ramathajim
Die Faltstühle und die Klapptische waren Zeugen eines unbeständigen Lebens
Die schweren Lastkraftwagen die auf der Fernstraße vorbeifuhren
Rüttelten alte Erinnerungen wach
Man braucht so wenig zum Weinen:
Ein wenig Erschütterung, ein bisschen Erinnerung, ein bisschen Schmerz
und etwas Wasser
Wasser, mit dem man die Zitronenhaine bewässert,
von dem vielen Wasser, das keine Liebe auslöscht
Es ist eine Todesanzeige
an den Stamm des dicken Baums geheftet
der goldene Kleister tropft noch wie Harz herab
und der Name des frisch Verstorbenen glitzert im Sonnenschein
Er trug den Namen einer Stadt jener Welt Europa.
Wie wenig Leute es gibt, deren Nachname der Name ihres Geburtsortes ist
oder des Ortes, wo sie leben und sterben.
Die Geschichte fließt träge, klebrig wie Lava aus einer fernen Eruption
Ein Kind in Eilath heißt nach Abraham vom Zweistromland.
Ein Toter in Ramathajim heißt nach einer fernen Stadt,
die er noch nie in seinem Leben sah.
Die meiste Zeit unseres Lebens sind wir mit den Toten beschäftigt.
Wir schließen ihre Augen, wickeln sie in Tücher,
betrauern sie und erinnern uns an sie,
leben in einem Haus von einem Toten erbaut,
lesen in einem Buch von einem Toten verfasst
leben nach Gesetzen von Toten bei ihren Lebzeiten in Kraft setzten
und erinnern uns an ihre Erinnerungen
Ich sitze in diesem Café an der Fernstraße
und esse gefüllten Kuchen, Seelenkuchen für alle Lebenden
O du wunderbarer Bäcker vor deinem Backofen,
du bist viel weiter als alle Wissenschaftler,
denn du weißt, dass Körper und Seele eins sind,
dass ein Krug und sein Inhalt eins sind,
und dass ein Kuchen und seine Füllung eins sind
wie der Mensch und sein Tod eins sind
Zum Abschluss möchte ich Ihnen nun das Gedichte Wie die Flüsse im Negev vorstellen.
Es erschien 1989 in Amichais vorletztem Gedichtband „Auch die Faust war einmal eine offene Hand und Finger“, gehört also zu seinem Spätwerk.
Wie die Flüsse im Negev spricht noch einmal alle großen Themen von Amichais Lyrik an:
• den Sinn des Lebens,
• die Familie
• ein Leben ohne Gott und eigentlich doch mit ihm,
• Krieg und Tod,
• Das Altwerden und die Liebe.
Es zeigt uns den lyrischen Sprecher als einen der auf sein Leben zurückblickt und von Tränen der Rührung über ein trotz allem geglücktes Leben übermannt wird, so wie die ausgetrockneten Flussbetten in der Wüste Negev von einem erfrischenden Regen.
Wie die Flüsse im Negev
Ich sitze in den Nachmittagsstunden in einem Café.
Meine Söhne sind groß, meine Tochter tanzt anderswo.
Ich habe keinen Kinderwagen, keine Zeitung, keinen Gott dabei.
Ich sehe eine Frau, deren Vater mit mir in der Negev-Schlacht gekämpft hat,
seine Augen sah ich aufgerissen vor Schmerz und Todesangst.
Nun sind sie im Gesicht seiner Tochter, ruhige, schöne Augen.
Ihr übriger Körper – von anderswoher, ihr Haar ist in Friedenszeiten gewachsen,
andere Genetik, andere Generation, eine andere Zeit, die ich nicht kannte.
Ich besitze viele Zeiten so, wie im Uhrengeschäft jede der vielen Uhren eine andere Zeit anzeigt.
Meine Erinnerungen sind über die ganze Erde verstreut
wie die Asche von einem, der seinen Körper nach dem Tod
verbrennen und seine Asche über die sieben Meere zerstreuen lässt.
Ich sitze. Stimmengerede umgibt mich
wie die hübsche Ornamentik eines Treppengeländers,
durch die ich die Straße höre.
Der Tisch vor mir ist für Schnellgerichte so geformt wie eine Bucht,
wie eine Hafenpier, wie die Hand des Herren,
wie Braut und Bräutigam.
Manchmal steigen in mir Glückstränen hoch
wie wenn eine leere Straße sich plötzlich mit Fahrzeugen füllt,
wenn die Ampel an einer fernen Kreuzung auf grün gesprungen ist
wie wenn die Flüsse im Negev plötzlich von der Flut entfernten Regens
Hochwasser führen.
Danach wieder Stille, Leere, wie die Flüsse im Negev,
wie die Flüsse im Negev.
Meine Damen und Herren,
ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen weiterhin eine schöne Adventszeit,
ein fröhliches Chanukka-Fest, eine Frohe Weihnacht und einen guten Rutsch, ein gutes Rosh Hashana 2021!
Amadé Esperer